
Faire Arbeitsmodelle: So erfüllst du die Bedürfnisse der Mitarbeitenden
Wie, wo und wann wir arbeiten, hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Homeoffice ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern ein fester Bestandteil vieler Arbeitsmodelle. Damit einhergehend stellt sich die Frage: Wie lassen sich Arbeitsmodelle so gestalten, dass sie den vielfältigen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden – und gleichzeitig Fairness, Produktivität und Teamzusammenhalt fördern?
Das Forschungsteam des Homeoffice Lab der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Universität Neuchâtel hat 2024 die Präferenzen und Realitäten von Arbeitnehmenden in der Schweiz in einer umfassenden Studie mit über 2’300 Teilnehmenden untersucht. Die Ergebnisse machen klar:
Die meisten Beschäftigten wünschen sich eine Balance zwischen Büro und Homeoffice. Während Flexibilität, weniger Pendelzeit und ein ruhigeres Umfeld klare Vorteile sind, treten gleichzeitig neue Fragen auf – etwa nach sozialer Verbundenheit, ergonomischen Arbeitsplätzen oder nach der „Fairness“ von Regeln. Unterschiede zwischen Eltern und Nicht-Eltern, Pendlern mit kurzen oder langen Arbeitswegen sowie individuellen Präferenzen machen deutlich: Ein „One-Size-Fits-All“-Ansatz funktioniert nicht.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Im Durchschnitt arbeiten Beschäftigte in der Schweiz 1,6 Tage pro Woche von zuhause. Erlaubt wären im Mittel 2,4 Tage, gewünscht sind 2,3 Tage. Ein Paradox: Es dürfte mehr Homeoffice sein – doch genutzt wird weniger.
Ein Grund dafür: Die Umsetzung hängt stark davon ab, wie Modelle geregelt sind. 30 Prozent der Befragten entscheiden gemeinsam mit Team und Vorgesetzten, 27 Prozent arbeiten nach zentralen Richtlinien, 25 Prozent in Eigenregie, während 18 Prozent klaren Vorgaben durch die Führungskraft folgen.
Hier zeigt sich bereits, was Fairness im Alltag bedeutet:
- Partizipation – wenn Teams ihre Regeln mitgestalten können, steigt die Akzeptanz.
- Flexibilität mit Leitplanken – wer Eigenregie hat, braucht trotzdem Orientierung, z. B. Mindesttage im Büro oder Absprachen für Teampräsenz.
- Klarheit statt Mikromanagement – Regeln, die nachvollziehbar sind, empfinden Mitarbeitende eher als fair.
Vorteile und Herausforderungen – und was daraus folgt
Viele Mitarbeitende schätzen die Vorteile: 81 Prozent den Wegfall der Pendelzeit, 64 Prozent die Ruhe, 57 Prozent die zeitliche Flexibilität. Gleichzeitig klagen 31 Prozent über unzureichende Ausstattung, 15 Prozent über schlechte Ergonomie. Hier wird deutlich: Faire Modelle sind nicht nur eine Frage von Tagen, sondern von Rahmenbedingungen.
- Unternehmen, die Arbeitsplatzzuschüsse oder Equipment-Pakete fürs Homeoffice bereitstellen, erhöhen die Chancengleichheit zwischen Mitarbeitenden.
- Ergonomische Stühle und Bildschirme zu Hause sind ebenso ein Fairnessfaktor wie ein gut ausgestattetes Büro mit Rückzugsräumen.
- Fairness bedeutet auch, Einsamkeit vorzubeugen: feste Teamtage, hybride Meetings mit gleichwertiger Teilhabe, oder Räume im Büro, die soziale Begegnung fördern.
Fairness als Erfolgsfaktor
Die Studie zeigt: 77 Prozent empfinden die Homeoffice-Regeln ihrer Organisation als fair – doch wo dies nicht der Fall ist, herrscht Erschöpfung und Frust. Fairness ist also kein Luxus, sondern Voraussetzung für Vertrauen. Praktisch heisst das:
- Transparenz: Regeln offen kommunizieren – warum gilt was, und für wen?
- Gleichbehandlung und individuelle Lösungen: Für die einen gleiche Spielregeln für alle, für andere massgeschneiderte Absprachen. Entscheidend ist, dass das Vorgehen begründet und verständlich ist.
- Regelmässige Überprüfung: Fairness ist dynamisch. Was vor zwei Jahren passte, muss heute angepasst werden – etwa, wenn neue Mitarbeitende dazukommen oder Teams ihre Arbeitsweise ändern.
Unterschiede in den Bedürfnissen – und die Lehre daraus
Nicht alle profitieren gleich vom Homeoffice. Eltern arbeiten im Schnitt 1,5 Tage zuhause, Nicht-Eltern 1,7 Tage. Während Eltern den Zeitgewinn mit der Familie betonen, sehen kinderlose Mitarbeitende Vorteile bei der schnelleren Tagesroutine.
Fairness bedeutet hier: Massnahmen, die unterschiedliche Lebensrealitäten anerkennen. Für Eltern können das flexible Kernzeiten oder die Möglichkeit sein, im Büro ruhige Zonen zu nutzen. Für Nicht-Eltern hingegen Anreize, soziale Kontakte zu pflegen – etwa durch Teamtage oder After-Work-Formate.
Auch beim Pendeln zeigen sich Unterschiede: Langstreckenpendler wünschen sich im Schnitt rund 3 Tage Homeoffice, Kurzstreckenpendler nur 2. Faire Modelle berücksichtigen daher die Pendelzeit – etwa mit individuellen Kontingenten oder der Möglichkeit, Reisetage durch mobiles Arbeiten zu kombinieren.
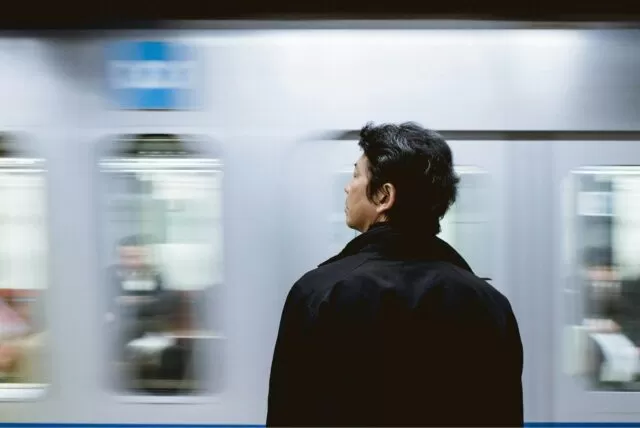
Wie lassen sich Modelle fair gestalten?
Die Studien zeigen klar: Ein faires Arbeitsmodell ist mehr als eine Regel zu Homeoffice-Tagen. Es ist ein Set aus Prinzipien:
- Mitgestaltung statt Verordnung – Mitarbeitende in Entscheidungsprozesse einbinden.
- Klare Leitplanken – Orientierung geben, aber individuelle Spielräume offenlassen.
- Ausstattung sichern – gleiche Chancen durch gute Infrastruktur im Büro und zuhause.
- Transparenz leben – Regeln und Begründungen nachvollziehbar machen.
- Soziale Nähe fördern – Teams Räume und Zeit für Begegnung geben.
- Regelmässig anpassen – Fairness bleibt nur erhalten, wenn Modelle überprüft und weiterentwickelt werden.
Die Zukunft der Arbeit – ein Balanceakt
Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Doch ob es als Gewinn oder Belastung empfunden wird, hängt weniger von der Zahl der Tage ab als von der Fairness der Gestaltung.
Für Unternehmen bedeutet das: Flexibilität ja, aber mit Struktur. Freiheit ja, aber nicht auf Kosten des Zusammenhalts. Wer dieses Gleichgewicht schafft, sorgt nicht nur für zufriedene Mitarbeitende – sondern stärkt auch Produktivität, Bindung und Attraktivität als Arbeitgeber.
Download
Die gesamten Studienergebnisse des Artikels und mehr gibt es im nachfolgenden Booklet nachzulesen: